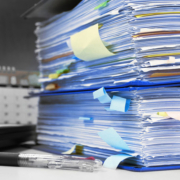Inventur durchführen und Inventurdifferenzen vermeiden: 14 Fragen und Antworten
Die alljährliche Bestandsaufnahme sämtlicher Vermögensgegenstände und Schulden, besser bekannt als Inventur, ist für Ihr Unternehmen auch jedes Mal eine Herausforderung? Dieser Beitrag beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Inventur und gibt Tipps, wie Sie Inventurdifferenzen vermeiden.
Jedes Unternehmen muss regelmäßig seinen tatsächlichen Warenbestand und seine sonstigen Wertbestände mit dem buchhalterischen Sollbestand abgleichen. Im Folgenden wird erläutert, welchem Zweck diese Inventur dient, wie sie richtig durchzuführen ist und wie sich Inventurdifferenzen verhindern lassen.
1. Was ist eine Inventur?
Die Inventur ist eine Ist-Aufnahme von Vermögen und Schulden in Ihrem Unternehmen, also die lückenlose Aufnahme des Bestands zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei bilanzierenden Unternehmen gehört sie zwingend zum Jahresabschluss.
2. Wozu dient die Inventur?
Die Inventur weist nach, dass Ihre Bilanz die tatsächlichen Verhältnisse im Unternehmen widerspiegelt. Diese Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit gehören zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Mit der Inventur beweisen Sie, dass Sie über Wareneingänge und -ausgänge ordnungsgemäß Buch geführt haben – und Ihre Wertansätze korrekt sind.
3. Welche Vorteile hat eine Inventur für Sie als Unternehmer?
Anhand der Inventur erhalten Sie einen guten Überblick über den Betrieb und seine Lage aus wirtschaftlicher Sicht. Außerdem vergewissern Sie sich, dass Ihre Vorräte keinen sogenannten “Schwund” aufweisen. Sie erkennen Ladenhüter und können diese durch Sonderabschreibungen abwerten. Unter dem Strich können Sie also den Wert Ihres Betriebs gut einschätzen.
4. Wann müssen Sie die Inventur durchführen?
Die Inventur steht grundsätzlich zum Ende des Geschäftsjahres an, also meist zum 31. Dezember.
5. Wie häufig sollte eine Inventur stattfinden?
Der Gesetzgeber fordert, dass der tatsächliche Bestand mindestens einmal jährlich gezählt, gemessen und schriftlich dokumentiert wird. Das Ergebnis muss den Buchbeständen entsprechen, die den Soll-Bestand widerspiegeln. Wenn das nicht der Fall ist, liegt eine Inventurdifferenz vor, die es zu vermeiden gilt.
6. Was müssen Sie bei der Erfassung der Inventur beachten?
Grundsätzlich erfasst eine Inventur sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Auf der Aktivseite sind dies beispielsweise Kassenbestände, Kontenguthaben, Wertpapiere, Beteiligungen, Forderungen, Vorräte, Anlagevermögen, Grundstücke und Gebäude sowie materielle und immaterielle Vermögenswerte. Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten erfasst. Diese Form der Inventur wird als Buchinventur bezeichnet.
In der Praxis bezieht sich der Begriff “Inventur” jedoch oft auf die physische Bestandsaufnahme von Waren, Rohstoffen und anderen materiellen Gütern im Unternehmen. Diese Güter bilden das Inventar. Die gezählten Bestände werden anschließend mit den Buchwerten der entsprechenden Sachkonten (Sollbestände) abgeglichen. Diese Sachkonten umfassen beispielsweise Posten unter “Vorräte”, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.
Es sei angemerkt, dass dieser Artikel einen stärkeren Fokus auf die Inventur von materiellen Gütern legt als auf die von Forderungen oder dem Anlagevermögen. Dies liegt daran, dass die Inventur von Lager- und Warenbeständen in Handel, Handwerk, Gastronomie und Industrie oft als die größere Herausforderung angesehen wird.
7. Welche Formen der Inventur gibt es und was sind die Unterschiede?
Prinzipiell existieren diverse Arten und Verfahren der Inventur, die sich mitunter deutlich voneinander unterscheiden. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die maßgeblichen Inventurmethoden:
Stichtagsinventur
Diese gängige Form der Inventur findet üblicherweise zwischen dem 31. Dezember und dem 10. Januar des Folgejahres zu einem festgelegten Termin oder Stichtag statt. Sie liegt in zeitlicher Nähe zum Jahresabschluss, da die Inventur die Richtigkeit der Bilanzansätze zum Bilanzstichtag nachweisen soll.
Zeitverschobene, vor- oder nachgelagerte Inventur
Die Stichtagsinventur darf bis zu drei Monate vor und bis zu zwei Monate nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Aufgrund der festgestellten Bestände und der Buchführung über Wareneingänge und Warenausgänge wird dann auf den Stichtag zurückgerechnet, um die Richtigkeit der Bilanz nachzuweisen.
Einzelhändler legen ihre Stichtagsinventur oft in den Januar, weil nach dem Weihnachtsgeschäft die Regale leer sind und es weniger zu zählen gibt. Wareneingänge und Warenausgänge werden dann mithilfe des Warenwirtschaftssystems auf den Bilanzstichtag zurückgerechnet.
Eine vor- oder nachgelagerte Inventur ist schwierig, wenn sich Warenbestände durch Verderb, Schwund, Verdunsten oder Ähnliches unkontrolliert ändern können. In solchen Fällen sollten Sie vorher eine Genehmigung des Finanzamts für dieses Vorgehen einholen.
Für diese Form der Inventur ist ein Warenwirtschaftssystem (WWS) zwingend notwendig.
Stichprobeninventur
Verfügen Sie über Lagerbestände, die aufgrund ihrer Beschaffenheit schwer durch Messen, Zählen und Wiegen zu ermitteln sind? In diesem Fall besteht die Möglichkeit, eine Teilerfassung der Vorräte vorzunehmen und die Bestände durch Hochrechnung anhand von Stichproben zu ermitteln. Auch diese Inventurmethode erfordert ein Warenwirtschaftssystem.
Permanente Inventur
Unternehmen haben auch die Möglichkeit, ihre Lagerbestände kontinuierlich über das gesamte Jahr zu erfassen und diese regelmäßig mit dem Warenwirtschaftssystem abzugleichen. Diese Inventurmethode erfordert ebenfalls die Nutzung eines Warenwirtschaftssystems.

8. Wer muss verpflichtend eine Inventur durchführen?
Lediglich bilanzierungspflichtige Unternehmen sind verpflichtet, eine Inventur durchzuführen. Diese Verpflichtung hängt von der Rechtsform sowie dem Umsatz ab. Kapitalgesellschaften wie GmbH, UG und AG fallen ebenso unter die Inventurpflicht wie Personengesellschaften à la OHG, KG und GmbH & Co. KG. Ebenfalls inventurpflichtig ist der eingetragene Kaufmann (e. K.).
Freiberufler, Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) und Kleingewerbetreibende (Unternehmen mit einem Jahresumsatz von maximal 600.000 Euro oder einem maximalen Jahresgewinn von 60.000 Euro) sind hingegen von der Inventurpflicht befreit.
9. In welchen Schritten sollten Sie die Inventur planen und durchführen?
Wenn Sie vor der Durchführung der Inventur die nachfolgende Checkliste sorgfältig abarbeiten, steht einem reibungslosen Ablauf kaum noch etwas im Weg:
- Termin festsetzen — Wählen Sie einen Termin aus, idealerweise in unmittelbarer Nähe zum Jahresabschluss, da eine spätere Terminierung die Rückrechnung zum Stichtag erschwert.
- Steuerberater einbeziehen — Für prüfungspflichtige Unternehmen ist dies Pflicht, für andere eine Empfehlung: Holen Sie Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit ins Boot, damit er Stichproben durchführen und sicherstellen kann, dass die Inventur korrekt erfolgt. Die Ergebnisse dieser Stichproben sind schriftlich zu dokumentieren.
- Inventurteams bilden — Teilen Sie Ihr Personal in Inventurteams ein und rekrutieren Sie rechtzeitig Hilfskräfte. Obwohl die Zweierteam-Struktur, bei der einer angibt und der andere erfasst, nicht zwingend vorgeschrieben ist, hat sich dieses Prinzip bewährt. Eine Inventur ohne das Vier-Augen-Prinzip neigt häufig zu Ungenauigkeiten und Fehlern.
- Umfang festlegen — Definieren Sie den Umfang der Inventur. Waren können gezählt, gemessen und gewogen werden, während bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wie Schrauben und Nägeln oft eine Schätzung ausreicht. Die Methode der “Schätzung” muss jedoch schriftlich dokumentiert werden. Alle drei Jahre sollten auch Dinge wie Nägel und Öldosen gezählt werden.
- Ware ordnen — Unterscheiden Sie zwischen Eigenware, Kundenware (eventuell für Reparaturen im Betrieb) und Waren von Dritten (wie Kommissionsware). Ordnen Sie Ihre Ware, beispielsweise nach Produktkategorien.
- Zählbereiche bilden — Die Arbeit mit Zählbereichen hat sich bewährt. Diese Bereiche entsprechen den Räumen, in denen sich das Inventar befindet, wie Schaufenster, Laden, Werkstatt, Lagerräume oder, bei umfangreichen Lagerflächen, einzelne Regale. Basierend auf den Zählbereichen erstellen Sie einen Inventurplan, dem Ihre Inventurteams folgen können.
- Vollständigkeit gewährleisten — Achten Sie beim Festlegen der Zählbereiche penibel auf Vollständigkeit. Vergessen Sie keine Ware, die sich möglicherweise außerhalb Ihres Betriebs, etwa in einer gemieteten Halle, befindet. Andernfalls könnten Probleme mit dem Finanzamt entstehen. Im schlimmsten Fall droht eine Steuerzuschätzung, was erhebliche Kosten verursachen kann.
10. Wie sollten Sie eine Inventur richtig durchführen?
Die Inventurteams erfassen die Lagerbestände mittels Zählen, Messen und Wiegen und folgen dabei dem vorher erstellten Inventurplan. Nach Abschluss jedes Zählbereichs führt der Inventurleiter oder der Steuerberater eine Stichprobe durch, um zu überprüfen, ob bestimmte Gegenstände erfasst wurden.
11. Wie lange dauert eine Inventur?
Die Dauer einer Inventur ist schwierig vorherzusagen. Es steht jedoch fest, dass das durchgängige Zählen von Waren über den gesamten Tag hinweg eine ermüdende Aufgabe sein kann. Um sicherzustellen, dass die Konzentration Ihrer Inventurteams erhalten bleibt, ist es ratsam, regelmäßige Pausen einzuplanen. Überwachen Sie aktiv, ob sämtliche Bestände korrekt gezählt werden.
12. Wie hilft ein Warenwirtschaftssystem Ihnen beim Durchführen der Inventur?
Am Ende jeder Inventur werden alle Aufzeichnungen zusammengefasst. Die Bewertung der Vorräte erledigt das Warenwirtschaftssystem für Sie, denn darin sind die Einkaufspreise der verschiedenen Gegenstände hinterlegt. Für das Vor- oder Zurückrechnen der Bestände und Werte auf den Bilanzstichtag ist ein Warenwirtschaftssystem unerlässlich.
Die Inventurlisten, die Ihre Teams ausfüllen, können Sie ebenfalls aus Ihrem Warenwirtschaftssystem ziehen. Diese Listen unterliegen der steuerlichen Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren. Im Rahmen der Dokumentation müssen Sie schriftlich festhalten:
- Wo wurden die Waren erfasst, etwa im Lager, im Geschäft, in der Werkstatt usw.?
- Welche Person hat Stichproben genommen?
- Wann wurden diese Stichproben genommen?
- Welche Inventurmethode wurde angewandt (insbesondere bei Schätzungen)?
13. Wie werten Sie die Ergebnisse der Inventur aus?
In Ihrem Warenwirtschaftssystem können Sie den Zählbestand oder Ist-Bestand mit dem Buchbestand oder Soll-Bestand vergleichen. Diese müssen rechnerisch übereinstimmen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Warenwirtschaftssoftware, relevante Kennzahlen bezüglich Wareneinsatz, Lagerumschlag und Durchschnittsbestände zu extrahieren und zu analysieren. Dies erlaubt Ihnen, festzustellen, welche Produkte sich schlecht verkaufen lassen, und in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater können Sie solche schwer verkäuflichen Güter bilanziell abwerten, was zu steuermindernden Sonderabschreibungen führt. In den meisten Fällen werden jedoch auch Inventurdifferenzen auftreten.
14. Wie lassen sich Inventurdifferenzen vermeiden?
Inventurdifferenzen kommen bei fast jeder Inventur vor. Mögliche Ursachen hierfür können Fehler während der Inventur selbst, fehlerhafte Buchungen, unrichtige Zuordnungen von Ware und Preis, Verderb, Beschädigung, der Verlust von Waren oder Schwund durch Diebstahl sein.
Es empfiehlt sich, zunächst zu überprüfen, ob korrekt gezählt wurde und die richtigen Preise im System verwendet wurden. Eine eingehende Untersuchung der Buchhaltung sowie eine genaue Überprüfung der Soll-Ist-Abstimmung sind ebenfalls ratsam.
Die Verwendung eines Warenwirtschaftssystems trägt maßgeblich dazu bei, viele Inventurdifferenzen von vornherein zu vermeiden. Es zeichnet präzise alle Wareneingänge und -ausgänge auf, ermöglicht eine permanente Bestandsverfolgung und erlaubt zeitnahe, korrekte Buchungen.
Lesen Sie auch:
>> Was ist ein Warenwirtschaftssystem?
>> Effiziente Lagerhaltung in 5 Schritten